krakau
30.12.05
28.12.05
Bagua und Daruma
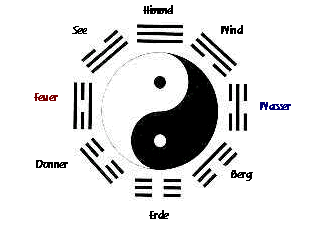
Wolfgang hat mir einen Geisterspiegel aus China mitgebracht, konkav, mit den acht Triagrammen rundherum – Bagua. Für mein Zimmer unter dem Dach.
Wolfgang hat uns aus Japan zwei Familienglücksdarumas mitgebracht. Im Duo-Pack. Einer ist rot, der andere weiß. Du kannst wählen. Bot er an. Großzügig wie immer. Und ich nehme, was übrig bleibt. Darumas haben zwei leere Augen, iris- und pupillenlos. Am Neujahrstag werden wir ein Auge ausmalen. Dies ist reines Futur eins. Wir werden einen schwarzen Punkt in die Mitte setzen, da uns Farben und Fähigkeiten für mehr fehlen. Wir werden dem einen leeren Auge den vollen Blick verleihen – und uns dabei etwas wünschen. Jeder für sich allein mit seinem Daruma. Ich mit dem weißen. Wolfgang mit dem roten. So wähle ich. Und ihm bleibt nichts anderes übrig. Die Welt ist ungerecht. Aber wenn unsere getrennten Wünsche, jeder für sich allein, in Erfüllung gegangen sein werden, werden wir das zweite Auge ausmalen müssen. Jeder an seinem Daruma. Dies ist reines Futur zwei. Einen schwarzen Punkt in die Mitte der Leere setzen. Dem toten Augenweiß den lebendigen Blick verleihen. Und den Pappmachékopf verbrennen. Jeder für sich allein.
Das Glück ist unaufhaltsam.
Der Geisterspiegel ist konkav. Das heißt, er hat eine nach innen gewölbte Linsenoberfläche und zieht die bösen Geister an wie ein klebriger Leimstreifen in Großmutters Bürner Küche die Fliegen im Hochsommer, und verglüht sie. Wäre der Spiegel konvex (auch solche gibt es zu kaufen in China), würde er das Böse auch anziehen und dann zerstreuen. Das hieße: gleichmäßig auf meine Nachbarn im Łaskihaus verteilen. Und all meine Martins rund um mich herum in ganz Krakau ins Unglück stürzen.
Das Unglück ist unaufhaltsam.
Wolfgang ist ein lebensfroher Mensch, wie kaum ein anderer. Deshalb hat er mir einen Geisterspiegel aus China mitgebracht, konkav, mit den acht Triagrammen rundherum – Bagua. Für mein Zimmer unter dem Dach. Für meine Nachbarn. Das Haus. Die Stadt. Und den Erdkreis.
Einen guten Rutsch und alles Gute im Neuen Jahr. Wir fahren morgen nach Danzig, zu Roma und Radek und Eva und Janusz. Meinen besten und ältesten Freunden in diesem Land. Ins Internet komme ich in diesem Jahr nicht mehr.
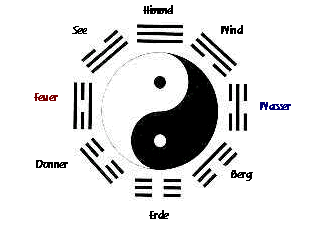
Wolfgang hat mir einen Geisterspiegel aus China mitgebracht, konkav, mit den acht Triagrammen rundherum – Bagua. Für mein Zimmer unter dem Dach.
Wolfgang hat uns aus Japan zwei Familienglücksdarumas mitgebracht. Im Duo-Pack. Einer ist rot, der andere weiß. Du kannst wählen. Bot er an. Großzügig wie immer. Und ich nehme, was übrig bleibt. Darumas haben zwei leere Augen, iris- und pupillenlos. Am Neujahrstag werden wir ein Auge ausmalen. Dies ist reines Futur eins. Wir werden einen schwarzen Punkt in die Mitte setzen, da uns Farben und Fähigkeiten für mehr fehlen. Wir werden dem einen leeren Auge den vollen Blick verleihen – und uns dabei etwas wünschen. Jeder für sich allein mit seinem Daruma. Ich mit dem weißen. Wolfgang mit dem roten. So wähle ich. Und ihm bleibt nichts anderes übrig. Die Welt ist ungerecht. Aber wenn unsere getrennten Wünsche, jeder für sich allein, in Erfüllung gegangen sein werden, werden wir das zweite Auge ausmalen müssen. Jeder an seinem Daruma. Dies ist reines Futur zwei. Einen schwarzen Punkt in die Mitte der Leere setzen. Dem toten Augenweiß den lebendigen Blick verleihen. Und den Pappmachékopf verbrennen. Jeder für sich allein.
Das Glück ist unaufhaltsam.
Der Geisterspiegel ist konkav. Das heißt, er hat eine nach innen gewölbte Linsenoberfläche und zieht die bösen Geister an wie ein klebriger Leimstreifen in Großmutters Bürner Küche die Fliegen im Hochsommer, und verglüht sie. Wäre der Spiegel konvex (auch solche gibt es zu kaufen in China), würde er das Böse auch anziehen und dann zerstreuen. Das hieße: gleichmäßig auf meine Nachbarn im Łaskihaus verteilen. Und all meine Martins rund um mich herum in ganz Krakau ins Unglück stürzen.
Das Unglück ist unaufhaltsam.
Wolfgang ist ein lebensfroher Mensch, wie kaum ein anderer. Deshalb hat er mir einen Geisterspiegel aus China mitgebracht, konkav, mit den acht Triagrammen rundherum – Bagua. Für mein Zimmer unter dem Dach. Für meine Nachbarn. Das Haus. Die Stadt. Und den Erdkreis.
Einen guten Rutsch und alles Gute im Neuen Jahr. Wir fahren morgen nach Danzig, zu Roma und Radek und Eva und Janusz. Meinen besten und ältesten Freunden in diesem Land. Ins Internet komme ich in diesem Jahr nicht mehr.
24.12.05
Weihnachten in Krakau
Business as usual: Wolfgang kocht (indisch scharf), ich wasche ab (helvetisch sauber).
Es nieselt. Der Wind ist zu warm. Die Stadt zu leer. Trotzdem eine Wintermütze gekauft. Und Magda M. aus Berlin im „Prowincja“ getroffen. Kaffee, Szarlotka, Cognac.
Fröhliche Weihnachtszeit Euch allen!
Es nieselt. Der Wind ist zu warm. Die Stadt zu leer. Trotzdem eine Wintermütze gekauft. Und Magda M. aus Berlin im „Prowincja“ getroffen. Kaffee, Szarlotka, Cognac.
Fröhliche Weihnachtszeit Euch allen!
22.12.05
Unter dem Dach
Wir sind zurückgekehrt. In mein Zimmer in Krakau. Wolfgang trägt seine Bücher, Papiere und Hemden über Krakau, Warschau, Danzig nach Stralsund. In der Küche liegt Post aus Kwiatonowice. Kasper schickt mir Kopien zu General Bijak. Ich weiß inzwischen, dass er eine Schwester hatte. Wir essen bei Jarema.
21.12.05
Berlin. Huttenstrasse
Café Bilderbuch. Um zehn. Akazienstraße. Ich habe sie alle einbestellt. Hildegard. Maria K. Rhea. In alphabetischer Reihenfolge. Mit Rhea war ich vor einem Jahr in Kwiatonowice. Im März trafen wir uns auf Maui, flogen über den Vulkan. Und jetzt. Wie immer. Kein Wunder. Sondern das Bilderbuch Café in Schöneberg. Maria K. runzelt die Stirn. Sie ist eine erfahrene Frau. Horoskope lügen. Nur Hildegard ist zuversichtlich.
Noch immer das Hauptbahnhofsgefühl. Bar jeglicher Hauptstadt. Das Leben im Sekundentakt.
Goslarer Platz. Nach eins. Wir kommen zu spät. Mittagessen bei Schwiegermutter. Seit Anfang Monat lebt sie allein.
Huttenstrasse. Um drei. Erster Stock. Mitten in der Stadt. Ein Seniorenheim. Schwiegervaters Augen leuchten. Er mag junge Frauen. Noch immer. Aber das ist auch schon alles. Die Hände suchen Beschäftigung. Der Kopf möchte nach Hause. Die Beine tragen den Körper nicht. Die Zunge bringt keinen Gedanken auf den Weg. Die Seele findet den Ausgang nicht. Draußen wird es bereits dunkel. Das Bewusstsein ist müde. Gegenüber bei WaKüFa kann man alles kaufen. Weiße Ware.
Noch immer das Hauptbahnhofsgefühl. Bar jeglicher Hauptstadt. Das Leben im Sekundentakt.
Goslarer Platz. Nach eins. Wir kommen zu spät. Mittagessen bei Schwiegermutter. Seit Anfang Monat lebt sie allein.
Huttenstrasse. Um drei. Erster Stock. Mitten in der Stadt. Ein Seniorenheim. Schwiegervaters Augen leuchten. Er mag junge Frauen. Noch immer. Aber das ist auch schon alles. Die Hände suchen Beschäftigung. Der Kopf möchte nach Hause. Die Beine tragen den Körper nicht. Die Zunge bringt keinen Gedanken auf den Weg. Die Seele findet den Ausgang nicht. Draußen wird es bereits dunkel. Das Bewusstsein ist müde. Gegenüber bei WaKüFa kann man alles kaufen. Weiße Ware.
20.12.05
Berlin. Engelbecken
Wie auf Knopfdruck springt die Sprache um. Auf Deutsch.
Um acht laufe ich um die Ecke zu meiner Hausärztin. Ich brauche meine dritte Tetanus-Spritze. Danach hätte ich für zehn Jahre Ruhe. Sagte sie vor einem Jahr. Und ermahnte mich, daran zu denken. Zeit wird immer relativer. Und die Gedanken immer klarer.
Wolfgang schläft ungefähr so lange, wie er im Flugzeug saß. Gestern. Oder vorgestern. Ich weiß nicht, woher die Zeit kommt.
Um zwölf laufe ich zum Lausitzer Platz zu meiner Friseuse. Ich will die Farbe auf meinem Kopf loswerden. Rote Reste noch aus Japan. Sie versteht nicht. Und ich mag nichts erklären.
Am Engelbecken wird gebaggert. Wie im ersten Winter. Wann war das? Nachdem wir in den Osten der Stadt gezogen waren. In den Schatten der Mauer. Die es damals schon nicht mehr gab. Zeit kennt keine Grenzen. Das Wasserbecken wird nun weiter ausgebaggert. Im Dezember. Das Ufer endlich (nach wie vielen Jahren?) ordentlich befestigt. Schotter aufgeschüttet. Schilf abgeschnitten. Die Schwäne sind weiß geworden und weggeflogen. Auch die Reiher haben das Weite gesucht. Der Winter kommt. Mit Riesenschritten. Der wievielte in diesem Jahr?
Um eins laufe ich zur Schönleinstrasse. Über das Kottbusser Tor. Wie durch einen riesigen Wartesaal. Eines Hauptbahnhofs. Im Niemandsland. Wo die Fahrtrichtungen aufgehoben wurden. Und das Zuhause abgeschafft.
Wolfgang fährt zu seinem Vater, der ihn nicht mehr erkennt.
Am Abend sitzen wir in unserer Küche und trinken Wein.
Der Erzengel auf dem Glockenturm der Ruine der Michaelskirche leuchtet nun in der Nacht. Irgendwoher fließt Geld. Über dem ehemaligen Todesstreifen wird die Zeit an den Himmel genagelt.
Um acht laufe ich um die Ecke zu meiner Hausärztin. Ich brauche meine dritte Tetanus-Spritze. Danach hätte ich für zehn Jahre Ruhe. Sagte sie vor einem Jahr. Und ermahnte mich, daran zu denken. Zeit wird immer relativer. Und die Gedanken immer klarer.
Wolfgang schläft ungefähr so lange, wie er im Flugzeug saß. Gestern. Oder vorgestern. Ich weiß nicht, woher die Zeit kommt.
Um zwölf laufe ich zum Lausitzer Platz zu meiner Friseuse. Ich will die Farbe auf meinem Kopf loswerden. Rote Reste noch aus Japan. Sie versteht nicht. Und ich mag nichts erklären.
Am Engelbecken wird gebaggert. Wie im ersten Winter. Wann war das? Nachdem wir in den Osten der Stadt gezogen waren. In den Schatten der Mauer. Die es damals schon nicht mehr gab. Zeit kennt keine Grenzen. Das Wasserbecken wird nun weiter ausgebaggert. Im Dezember. Das Ufer endlich (nach wie vielen Jahren?) ordentlich befestigt. Schotter aufgeschüttet. Schilf abgeschnitten. Die Schwäne sind weiß geworden und weggeflogen. Auch die Reiher haben das Weite gesucht. Der Winter kommt. Mit Riesenschritten. Der wievielte in diesem Jahr?
Um eins laufe ich zur Schönleinstrasse. Über das Kottbusser Tor. Wie durch einen riesigen Wartesaal. Eines Hauptbahnhofs. Im Niemandsland. Wo die Fahrtrichtungen aufgehoben wurden. Und das Zuhause abgeschafft.
Wolfgang fährt zu seinem Vater, der ihn nicht mehr erkennt.
Am Abend sitzen wir in unserer Küche und trinken Wein.
Der Erzengel auf dem Glockenturm der Ruine der Michaelskirche leuchtet nun in der Nacht. Irgendwoher fließt Geld. Über dem ehemaligen Todesstreifen wird die Zeit an den Himmel genagelt.
19.12.05
Das Leben in weiß
 Unser Pinguinleben: Wiedersehen in Berlin. Wolfgang fliegt gegen den Wind. Vierzehn statt dreizehn Stunden. Verpasst den Anschluss in Frankfurt. Landet mit einer späteren Maschine in Tegel. Sein Koffer bleibt auf der Strecke. Ich lande pünktlich in Schönefeld. Marschiere mit Handgepäck auf den S-Bahnhof zu.
Unser Pinguinleben: Wiedersehen in Berlin. Wolfgang fliegt gegen den Wind. Vierzehn statt dreizehn Stunden. Verpasst den Anschluss in Frankfurt. Landet mit einer späteren Maschine in Tegel. Sein Koffer bleibt auf der Strecke. Ich lande pünktlich in Schönefeld. Marschiere mit Handgepäck auf den S-Bahnhof zu.
Unser Pinguinleben: wir essen bei Toni. Wolfgang ist müde. Ich warte in der Nacht auf seinen Koffer. Bin zu Gast in der eigenen Wohnung. Suche auf meinem leeren Schreibtisch Spuren. Der Koffer klopft nach Mitternacht an die Tür. Der Kofferausträger fragt, ob ich Steine sammle. Ja, sage ich. Aber dies ist der Koffer meines Mannes. Der bereits selig schläft. Träumt. Irgendwo zwischen Guangzhou und Berlin. Ich komme nur aus Krakau. Und weiß dennoch nicht mehr, wo ich hin gehöre.
 Unser Pinguinleben: Wiedersehen in Berlin. Wolfgang fliegt gegen den Wind. Vierzehn statt dreizehn Stunden. Verpasst den Anschluss in Frankfurt. Landet mit einer späteren Maschine in Tegel. Sein Koffer bleibt auf der Strecke. Ich lande pünktlich in Schönefeld. Marschiere mit Handgepäck auf den S-Bahnhof zu.
Unser Pinguinleben: Wiedersehen in Berlin. Wolfgang fliegt gegen den Wind. Vierzehn statt dreizehn Stunden. Verpasst den Anschluss in Frankfurt. Landet mit einer späteren Maschine in Tegel. Sein Koffer bleibt auf der Strecke. Ich lande pünktlich in Schönefeld. Marschiere mit Handgepäck auf den S-Bahnhof zu. Unser Pinguinleben: wir essen bei Toni. Wolfgang ist müde. Ich warte in der Nacht auf seinen Koffer. Bin zu Gast in der eigenen Wohnung. Suche auf meinem leeren Schreibtisch Spuren. Der Koffer klopft nach Mitternacht an die Tür. Der Kofferausträger fragt, ob ich Steine sammle. Ja, sage ich. Aber dies ist der Koffer meines Mannes. Der bereits selig schläft. Träumt. Irgendwo zwischen Guangzhou und Berlin. Ich komme nur aus Krakau. Und weiß dennoch nicht mehr, wo ich hin gehöre.
17.12.05
Doppelpunkt
Hausaufgaben. Auf den Genitiv folgt unverzüglich eine Interpunktion. Der Doppelpunkt. Nazar schickte eine email aus Lwow. Keinen Brief. In der bekannten poetischen Verkürzung. Ohne Punkt. „Danke für die Herbstverbesserung”. Deutsch. Und Polnisch: „Dziękuję za uświetnienie jesieni”. Die Gedanken kehren zurück in alte Zeiten. Herbstblätter. Und Gott. Der in Nazars Gedicht ein unbestimmtes Fürwort ist. Bei mir, wäre ich eine Dichterin, würde er höchstens ein Komma verdienen. Die Augen hingegen versinken im Schnee. Vor dem Fenster. In der Luft. Auf dem Dach. Gleich wird er alles zudecken. Warmer, dichter, frischer, feuchter Schnee. Und ich werde nichts mehr sehen. Noch fühlen. Nach Mitternacht rufe ich zum letzten Mal in diesem Jahr Wolfgang in Guangzhou an. Wecke ihn. Denn bei ihm ist die Nacht bereits vorbei. Ich will, dass er sein Flugzeug nicht verpasst. Er schließlich auch. Dann lege ich mich hin. Und überschlafe den letzten Schmerz der Einsamkeit.
Heute überlebte ich einen Poesieabend mit Wisława Szymborska. In Krakau, im Zentrum der Japanischen Kunst manggha. Im Mai überlebte ich eine Lesung mit Tadeusz Konwicki. In Warschau, im Café des Verlags Czytelnik. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wie das so ist. Außer der Tatsache, dass es in beiden Fällen regnete. Das heißt, heute hat es eben aufgehört. Und gleich legt sich hier eine dicke Schicht weichen Schnees über alles. Außer der Tatsache, dass heue Szymborska und damals Konwicki sich bereit erklärten, ihre Bücher zu signieren. Die Gefälligkeit verdienter Schriftsteller verwandelt die Menge der Bewunderer in eine gefräßige Meute. Tut mir leid, aber ich kenne dafür kein anderes Wort. Das hat Canetti seiner Lebtag nicht erlebt. Eine Masse von Verehrern im Zentrum der Japanischen Kunst vor dem Tisch der Literaturnobelpreisträgerin. Eine Masse von Verehrern im Café Czytelnik vor dem Tisch des Meisters. Die Frau Verlegerin bat heute immer wieder um Verständnis. Leise und höflich. Dass, bitte, so nicht. Absolut unfassbar. Dieses Gedränge. Meine Damen, meine Herren. Sie dürfen die Dichterin nicht zerquetschen. Nicht die Preisträgerin. Der Herr Verleger betrachtete ohne ein Wort das Tun. In seiner Anzugsschwärze. Er sicherte seine Kollegin von hinten ab. Ich weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Denn ich kenne ihn. Ich lese es seinen Augen ab. Seiner hohen Stirn. Ein Gedicht entsteht. Das nächste. Und ich, die ich keine Dichterin bin, beneide ihn. Um das Talent. Die Gabe. Das Handwerk. Der kurzen Form. Der prägnanten Formulierung. Der männlichen Worte. Ich bin langatmig. Weitschweifig. Brauche Unmengen von Wörtern. Und die Gewährsmänner aus der Bibliothek in der Wohnung beim Erzengel. Mir kommt nur Elias Canetti in den Sinn. Seine Bücher. Aus dem Regal im Flur. Masse und Macht. Die Jagdmeute. Das Gewissen der Worte. Canetti hat zeitlebens keine polnische Schlange erlebt. Ich bereits zum zweiten Mal. So eine. Postsozialistische. Schlange. Wilder Tiere. In der es keinen Anstand mehr gibt. Mit Verlaub. Ich lese keine Gedichte. Das gebe ich offen zu. Aber gerne lausche ich ihnen. Aus dem Mund von Dichterinnen. Die Bescheidenheit von Frau Szymborskas Worten. Ging schnell unter in der gierigen polnischen postkommunistischen Hetzmeute. Dafür kann ich nun wirklich nichts. Eine Frau schreit verzweifelt „Wo ist denn hier die Hauptströmungsrichtung der Schlange?”, denn ihr scheint, sie stünde auf der Seite des Theatersaals im manggha, auf der die Schlange sich um kein Jota vorwärts bewege. Deshalb stößt sie mit allen Kräften. Und Ellbogen. In meinen Rücken. Eine andere neben mir klagt über den Mangel an Logistik. Und ich schnappe nach Luft.
Ich überlebte. Bedankte mich beim Verleger. Leichter um mindestens zwei Kilo Körperflüssigkeit. Lebendgewicht. Schweißgebadet. An der Haltestelle wartete ich auf den Bus und spürte die Verkühlung. In der Nacht. Im Bus. Nach Hause. Las ich alle Gedichte durch. Der Band endet mit einem Doppelpunkt. Und ist offen. Rund. Geschlossen. Nie wieder werde ich eine polnische Dichterin oder einen polnischen Schriftsteller nach einer Lesung in Polen um ein Autogramm bitten. Schade um die Worte.
Nach Mitternacht rufe ich zum letzten Mal in diesem Jahr Wolfgang in Guangzhou an. Wecke ihn. Denn bei ihm ist die Nacht bereits vorbei. Bis morgen wird alles mit einer dicken Schicht unschuldigen Schnees zugedeckt sein. Und ich werde nichts mehr sehen. Noch spüren. Noch hören. Ich will, dass er sein Flugzeug nicht verpasst. Und überschlafe den letzten Schmerz der Einsamkeit. Auf den Genitiv folgt immer nur der Doppelpunkt.
Heute überlebte ich einen Poesieabend mit Wisława Szymborska. In Krakau, im Zentrum der Japanischen Kunst manggha. Im Mai überlebte ich eine Lesung mit Tadeusz Konwicki. In Warschau, im Café des Verlags Czytelnik. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wie das so ist. Außer der Tatsache, dass es in beiden Fällen regnete. Das heißt, heute hat es eben aufgehört. Und gleich legt sich hier eine dicke Schicht weichen Schnees über alles. Außer der Tatsache, dass heue Szymborska und damals Konwicki sich bereit erklärten, ihre Bücher zu signieren. Die Gefälligkeit verdienter Schriftsteller verwandelt die Menge der Bewunderer in eine gefräßige Meute. Tut mir leid, aber ich kenne dafür kein anderes Wort. Das hat Canetti seiner Lebtag nicht erlebt. Eine Masse von Verehrern im Zentrum der Japanischen Kunst vor dem Tisch der Literaturnobelpreisträgerin. Eine Masse von Verehrern im Café Czytelnik vor dem Tisch des Meisters. Die Frau Verlegerin bat heute immer wieder um Verständnis. Leise und höflich. Dass, bitte, so nicht. Absolut unfassbar. Dieses Gedränge. Meine Damen, meine Herren. Sie dürfen die Dichterin nicht zerquetschen. Nicht die Preisträgerin. Der Herr Verleger betrachtete ohne ein Wort das Tun. In seiner Anzugsschwärze. Er sicherte seine Kollegin von hinten ab. Ich weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Denn ich kenne ihn. Ich lese es seinen Augen ab. Seiner hohen Stirn. Ein Gedicht entsteht. Das nächste. Und ich, die ich keine Dichterin bin, beneide ihn. Um das Talent. Die Gabe. Das Handwerk. Der kurzen Form. Der prägnanten Formulierung. Der männlichen Worte. Ich bin langatmig. Weitschweifig. Brauche Unmengen von Wörtern. Und die Gewährsmänner aus der Bibliothek in der Wohnung beim Erzengel. Mir kommt nur Elias Canetti in den Sinn. Seine Bücher. Aus dem Regal im Flur. Masse und Macht. Die Jagdmeute. Das Gewissen der Worte. Canetti hat zeitlebens keine polnische Schlange erlebt. Ich bereits zum zweiten Mal. So eine. Postsozialistische. Schlange. Wilder Tiere. In der es keinen Anstand mehr gibt. Mit Verlaub. Ich lese keine Gedichte. Das gebe ich offen zu. Aber gerne lausche ich ihnen. Aus dem Mund von Dichterinnen. Die Bescheidenheit von Frau Szymborskas Worten. Ging schnell unter in der gierigen polnischen postkommunistischen Hetzmeute. Dafür kann ich nun wirklich nichts. Eine Frau schreit verzweifelt „Wo ist denn hier die Hauptströmungsrichtung der Schlange?”, denn ihr scheint, sie stünde auf der Seite des Theatersaals im manggha, auf der die Schlange sich um kein Jota vorwärts bewege. Deshalb stößt sie mit allen Kräften. Und Ellbogen. In meinen Rücken. Eine andere neben mir klagt über den Mangel an Logistik. Und ich schnappe nach Luft.
Ich überlebte. Bedankte mich beim Verleger. Leichter um mindestens zwei Kilo Körperflüssigkeit. Lebendgewicht. Schweißgebadet. An der Haltestelle wartete ich auf den Bus und spürte die Verkühlung. In der Nacht. Im Bus. Nach Hause. Las ich alle Gedichte durch. Der Band endet mit einem Doppelpunkt. Und ist offen. Rund. Geschlossen. Nie wieder werde ich eine polnische Dichterin oder einen polnischen Schriftsteller nach einer Lesung in Polen um ein Autogramm bitten. Schade um die Worte.
Nach Mitternacht rufe ich zum letzten Mal in diesem Jahr Wolfgang in Guangzhou an. Wecke ihn. Denn bei ihm ist die Nacht bereits vorbei. Bis morgen wird alles mit einer dicken Schicht unschuldigen Schnees zugedeckt sein. Und ich werde nichts mehr sehen. Noch spüren. Noch hören. Ich will, dass er sein Flugzeug nicht verpasst. Und überschlafe den letzten Schmerz der Einsamkeit. Auf den Genitiv folgt immer nur der Doppelpunkt.
14.12.05
Genitiv und Akkusativ
Noch nicht einmal Mitte Dezember, und schon habe ich die letzte Polnischstunde diesen Jahres hinter mir. Gut, dass mein Stipendium verlängert wurde. Denn noch ist nichts eingedrungen. Gar nichts. In das Bewusstsein. Den Verstand. Die Fingerspitzen. Von dieser Sprache. Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, alles würde sich verflüchtigen. Der Kopf sich in reiner Luft auflösen. Vollkommen. Die Gedanken. Das Hirn. Die Zellen. Befänden sich irgendwo außerhalb. Von mir. Der Körper außer sich. Und außer mir. Zersetzte sich in einzelne Martinwörter. Im Gymnastikraum unter dem Dach. Im Kulturklub „Wola”.
„Wola” ist immer noch ein Warschauer Stadtbezirk. In meiner Seele. Dagegen komme ich nicht an. Die Rabsztyńska-Straße. Dort wohnte ich in jenem Jahr, in dem ich in Warschau arbeitete. Und gegen dessen Ende wir heirateten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Gar nichts. Kein Taxifahrer wusste, wo sie ist. Diese Rabsztyńska-Straße. In Wola. Und hier Wirbelsäule. Schultern. Arme. Das Entfalten des Seidenkokons. Oder chinesisch Chan si gong. Und ich fürchte mich jetzt. Was auch immer. Zu sagen. Zu schreiben. Bin auf der Lauer. Und kontrolliere mich. Um keine Dummheiten zu machen. Ein Satz aus dem offenen Wörterbuch. Auf dem Bildschirm des Laptops. Hinter dem Text. Im nächsten Fenster. Andauernd gucke ich etwas nach. In einem Fenster. Vollendete Verbform. In jenem Fenster. Ein Verb der unvollendeten Bewegung. Im Polnischen geht man sozusagen das ganze Leben in die Schule und kann nie aufhören. Zu gehen. Ich habe die Unschuld verloren. Die Fragezeichen bohren sich in meine Stirn. Bestimmt geht das so nicht. Im Polnischen. Und Grażynka malt mir hier gleich ein rotes keep smiling in den Text. Ein Emotikon. Ein normales Lächeln. Oder ein verschmitztes. Ich habe die Zuversicht verloren. In Wola Justowska.
Heute die letzte Lektion. In diesem Jahr. Wie gut, dass mein Stipendium verlängert wurde. Heute Genitiv und Akkusativ. Die Flexion der Substantive. Die männlichbelebten Formen. Die nichtmännlichbelebten Formen. Das heißt die Sachformen. Martin der Ältere im Zimmer unter mir lacht mich aus, dass ich mir Gedanken darüber mache, warum genitivus polnisch „dopełniacz“ heißt und acusativus „biernik“. Darüber, dass das Wort „biernik” meiner Meinung nach etymologisch ähnliche Wurzeln haben muss (und deshalb auch eine ähnliche Bedeutung) wie „bierny” [passiv], „bierność” [Passivität] – und „dopełniacz“ wie „dopełnić” [auffüllen]. Er lacht und liest „Privatkorrespondenzen“ im Lemberger Kurier aus dem Jahr 1892. Und für mich ist plötzlich alles ein Problem. Sprachlich. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ob das Wort „osoba” [Person] eine Person ist oder eine Sache. Ob es ein Substantiv weiblichen Geschlechts ist oder eine nichtmännlichbelebte Sache. Und ob zwischen dem einen und dem anderen überhaupt ein Unterschied besteht. Die Lehrerin warf heute ganz unbedacht den Gedanken in mein Notizheft, dass eigentlich niemand sagen kann, ob es sich hier um einen Genitiv oder um einen Akkusativ handle. Dieses berühmte „kogo/co” [wessen/was], das man mir in den Kopf gehauen hat wie eine Axt, schon in der ersten Polnischstunde, in den ersten Momenten in diesem Land, während der ersten Berührungen mit dieser Sprache. „Kogo/co“ – das schien mir immer absolut unangebracht. Aber alle wiederholten es leidenschaftslos. Wessen. Was. Die Studenten der Polonistik. In der stickigen Universitätsbibliothek. Nach jedem Verb. Der Bewegung. Oder Rührung. Kaufen. Wessen/Was? Lieben. Wessen/Was? Gedenken. Wessen/Was? Zuzia. Mein Gott. Wie lang ist das her. Wessen/Was? Ich habe an diese Frage nie geglaubt. Und deshalb weiß ich bis heute nicht. Warum Herr X im Polnischen einen Mercedes oder einen Fiat im Genitiv kauft. Und Herr Y ein Auto. Im Akkusativ. Warum der eine Genitivbesessen. Der andere Akkusativbelassen. Ist. Und nun plötzlich alles verschwimmt. Es unklar bleibt, ob dieser Genitiv nicht eigentlich ein gleichlautender Akkusativ ist. Alle schreiben heute emails und sms – im Polnischen im Genitiv. Der Briefträger händigt nach wie vor jeden eingeschriebenen Brief im Akkusativ aus. Heute verlor ich das letzte Vertrauen. In meine Fingerspitzen. Computertasten. Und Grammatikbegriffe. Worin zum Henker besteht die männliche Belebtheit eines Autos der Marke Fiat?
Randbemerkung von G.:
Zum Teufel mit Casus und männlicher Belebtheit, kogo/co – Es ist höchste Zeit, der Intuition zu vertrauen. Ich bin überzeugt, dass du dir erlauben kannst. Und keinen Schaden nimmst. Keine Gefahr läufst.
„Wola” ist immer noch ein Warschauer Stadtbezirk. In meiner Seele. Dagegen komme ich nicht an. Die Rabsztyńska-Straße. Dort wohnte ich in jenem Jahr, in dem ich in Warschau arbeitete. Und gegen dessen Ende wir heirateten. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Gar nichts. Kein Taxifahrer wusste, wo sie ist. Diese Rabsztyńska-Straße. In Wola. Und hier Wirbelsäule. Schultern. Arme. Das Entfalten des Seidenkokons. Oder chinesisch Chan si gong. Und ich fürchte mich jetzt. Was auch immer. Zu sagen. Zu schreiben. Bin auf der Lauer. Und kontrolliere mich. Um keine Dummheiten zu machen. Ein Satz aus dem offenen Wörterbuch. Auf dem Bildschirm des Laptops. Hinter dem Text. Im nächsten Fenster. Andauernd gucke ich etwas nach. In einem Fenster. Vollendete Verbform. In jenem Fenster. Ein Verb der unvollendeten Bewegung. Im Polnischen geht man sozusagen das ganze Leben in die Schule und kann nie aufhören. Zu gehen. Ich habe die Unschuld verloren. Die Fragezeichen bohren sich in meine Stirn. Bestimmt geht das so nicht. Im Polnischen. Und Grażynka malt mir hier gleich ein rotes keep smiling in den Text. Ein Emotikon. Ein normales Lächeln. Oder ein verschmitztes. Ich habe die Zuversicht verloren. In Wola Justowska.
Heute die letzte Lektion. In diesem Jahr. Wie gut, dass mein Stipendium verlängert wurde. Heute Genitiv und Akkusativ. Die Flexion der Substantive. Die männlichbelebten Formen. Die nichtmännlichbelebten Formen. Das heißt die Sachformen. Martin der Ältere im Zimmer unter mir lacht mich aus, dass ich mir Gedanken darüber mache, warum genitivus polnisch „dopełniacz“ heißt und acusativus „biernik“. Darüber, dass das Wort „biernik” meiner Meinung nach etymologisch ähnliche Wurzeln haben muss (und deshalb auch eine ähnliche Bedeutung) wie „bierny” [passiv], „bierność” [Passivität] – und „dopełniacz“ wie „dopełnić” [auffüllen]. Er lacht und liest „Privatkorrespondenzen“ im Lemberger Kurier aus dem Jahr 1892. Und für mich ist plötzlich alles ein Problem. Sprachlich. Ich weiß nicht, zum Beispiel, ob das Wort „osoba” [Person] eine Person ist oder eine Sache. Ob es ein Substantiv weiblichen Geschlechts ist oder eine nichtmännlichbelebte Sache. Und ob zwischen dem einen und dem anderen überhaupt ein Unterschied besteht. Die Lehrerin warf heute ganz unbedacht den Gedanken in mein Notizheft, dass eigentlich niemand sagen kann, ob es sich hier um einen Genitiv oder um einen Akkusativ handle. Dieses berühmte „kogo/co” [wessen/was], das man mir in den Kopf gehauen hat wie eine Axt, schon in der ersten Polnischstunde, in den ersten Momenten in diesem Land, während der ersten Berührungen mit dieser Sprache. „Kogo/co“ – das schien mir immer absolut unangebracht. Aber alle wiederholten es leidenschaftslos. Wessen. Was. Die Studenten der Polonistik. In der stickigen Universitätsbibliothek. Nach jedem Verb. Der Bewegung. Oder Rührung. Kaufen. Wessen/Was? Lieben. Wessen/Was? Gedenken. Wessen/Was? Zuzia. Mein Gott. Wie lang ist das her. Wessen/Was? Ich habe an diese Frage nie geglaubt. Und deshalb weiß ich bis heute nicht. Warum Herr X im Polnischen einen Mercedes oder einen Fiat im Genitiv kauft. Und Herr Y ein Auto. Im Akkusativ. Warum der eine Genitivbesessen. Der andere Akkusativbelassen. Ist. Und nun plötzlich alles verschwimmt. Es unklar bleibt, ob dieser Genitiv nicht eigentlich ein gleichlautender Akkusativ ist. Alle schreiben heute emails und sms – im Polnischen im Genitiv. Der Briefträger händigt nach wie vor jeden eingeschriebenen Brief im Akkusativ aus. Heute verlor ich das letzte Vertrauen. In meine Fingerspitzen. Computertasten. Und Grammatikbegriffe. Worin zum Henker besteht die männliche Belebtheit eines Autos der Marke Fiat?
Randbemerkung von G.:
Zum Teufel mit Casus und männlicher Belebtheit, kogo/co – Es ist höchste Zeit, der Intuition zu vertrauen. Ich bin überzeugt, dass du dir erlauben kannst. Und keinen Schaden nimmst. Keine Gefahr läufst.
13.12.05
Martin zum Sechsten
Martin Teil Fünf siehe „Die zweite Engelin”. Es wimmelt von Martins. In meinem Krakauer Alltag. Von einem war hier noch entschieden zu wenig. Die Rede. Obwohl auch er ununterbrochen Teil hat. An meinem Leben. An meinem Schreiben. Martin der Übersetzer.
Martin, der Übersetzer arbeitet in einer Buchhandlung. Und ist eigentlich Deutscher. Ich schreibe absichtlich „eigentlich”. Weil, wie wir wissen. Ein Deutscher, der seit drei Jahren in einer Krakauer Buchhandlung arbeitet. Ein Deutscher, der seit fünf Jahren an der Jagiellonen-Universität römisches Recht lehrt. Eine Schweizer Stipendiatin. Wir alle haben eine Staatsbürgerschaft. Für Nichts und wieder Nichts. Besitzen einen Pass. Zum Schein. Und zur Erleichterung von Grenzüberschreitungen. In Wirklichkeit ziehen wir es vor. In Polen. Zu leben, zu arbeiten, wenig zu verdienen, eine gute Zeit zu verbringen.
Martin der Übersetzer. Übersetzte einen Auszug aus „Seiden”. Aus dem Deutschen ins Englische. Erstaunlich gut. Und so spricht er auch Polnisch. Erstaunlich gut. Seit über einem Monat wechseln wir regelmäßig nachmitternächtliche emails. Treffen uns in der Buchhandlung. Er schäumt Milch für meine Latte Macchiato. Oder ist mit der Waschmaschine beschäftigt. In dieser Buchhandlung ist alles möglich. Und vorhanden. Martin ist sehr jung. Sehr sensibel. Sieht eher aus wie ein Mensch der Musik. Dachte ich. Irgendeinmal ganz am Anfang. Beiläufig. Sinnlos. Niemand braucht solche Gedanken.
In der Nacht vor meiner Abreise nach Rzeszów begriff ich endlich. Wir sind nicht gewappnet. Gegen Verstehen. Oder Nichtverstehen. Dummheit. Geistige Schlitzohrigkeit. Der Himmel weiß, woher das alles kommt und wohin es geht. Im Frühling, kaum zurück aus Japan, fuhr ich zu einem Tai Chi Wochenende ans Meer. Nach Usedom. Ahlbeck. An die Grenze. Zu Polen. Ich erinnerte mich an unsere unendlichen Spaziergänge. Während der Mittagspause. Über alten Sand. Im scharfen Wind. Einen Tag in die eine Richtung. Nach Nordosten. Bis nach Heringsdorf. Am nächsten Tag in die andere Richtung. Nach Südosten. Bis zur Landesgrenze. Auf feuchtem Sand. Und dort irgendwo an der salzarmen Ostsee zwischen dem einen Land und dem anderen, in the middle of nowhere, erzählte mir die Flötenlehrerin von ihrem Schüler. Der nach Polen „emigriert“ sei. Nach Krakau. Ich wunderte mich. Die Lehrerin ist jung, wie kann sie erwachsene, volljährige Schüler haben? Sie erzählte unbekümmert weiter, dass sie ihn einmal besucht habe. In Krakau. Dass er in einer Buchhandlung arbeite.
Und in der Tat. Erst in der Nacht vor meiner Abreise nach Rzeszów. Begriff ich. Dass es nicht zwei Entflohene geben kann. Aus Deutschland. Dass es Martin der Übersetzer aus dem Deutschen ins Englische sein muss. Es gibt ja noch einen anderen Martin. Der übersetzt. Aus dem Polnischen ins Deutsche. Von ihm später mehr. Ich begriff, dass Martin, mein Übersetzer, der Altblockflötenschüler der Berliner Tai Chi praktizierenden Flötenlehrerin sein muss.
Auch der dritte Martin, mein Chen Taijichuan-Lehrer ist allgegenwärtig in meinem Krakauer Alltag. Jeden Tag denke ich an ihn, wenn ich nicht die neue Form übe, die er mir beizubringen versucht. Sondern die alte, die mir von Berlin vertraut ist. Und bereits in meinem Körper Platz genommen hat.
Gestern war ich zum ersten Mal im Zimmer von Martin, dem Älteren unter mir. Im Łaskihaus. Bei Tageslicht. Ich gestehe, dass ich schon das eine oder andere Mal abends bei ihm sass. Bei einem bescheidenen Gläschen Rotwein. Wenn in der Küche Kochrituale zu Gange waren. Und uns der Fettgestank zu Leibe rückte. Gestern früh klopfte ich also an die Tür von Martin, dem Älteren. Der auch Übersetzer ist. Bevor er das Haus Richtung Bibliothek verließ. Kein Morgenmuffel. Dieser Martin ist eher ein Mensch der Bücher als ein Mensch der Musik, geschweige denn der Sopran- oder Altflöte. Ich bat ihn, mir zwei Angaben zu überprüfen. Zwei Bücher auszuleihen. Ein paar Seiten zu kopieren (es geht natürlich um General Bijak). Ich hatte keine Lust auf Bibliothek. Nicht an diesem Morgen. Und an keinem anderen. Ich sah vor seinem Fenster den alten Baumstamm. Und begriff, dass dies der Anfang des Baumes sein musste, der über meinem Dachfenster im Himmel endet. Ich starre täglich stundenlang in seine kahlen Äste. Die im blassen Winterhimmel aussehen wie die Ärmchen unzähliger hungriger Kinder. Unten, vor Martins Fenster, steht der Baumstamm. Und sieht nicht gesund aus. Alt. Müde. Morsch. Bei mir oben zeigt er weder sein Alter noch seine Wunden. Tut jung und übermütig. Gierig. Nach dem Leben.
Es wimmelt von Martins. Gestern Abend versammelten wir uns geschlossen, die ganze Belegschaft des Łaskihauses, alle großen und kleinen „M“, aber auch sämtliche anderen Buchstaben des Alphabets – zu einem literarischen Abend im Goethe Institut. Dort sass auch Martin, der Übersetzer ins Englische und Flötenschüler meiner Tai Chi Freundin. Gegen Ende der Veranstaltung, niemand weiß warum, gegen Ende dieses multimedialen happenings zum Stichwort „junge berliner szene“ wurde ein Stück kurzer Prosa von Tilmann Rammstedt gelesen. Titel: Das Mundstück. Protagonistin: die Flötenlehrerin. Protagonist: der Ich-Erzähler, ehemaliger Schüler der Flötenlehrerin.
Martin, der Übersetzer arbeitet in einer Buchhandlung. Und ist eigentlich Deutscher. Ich schreibe absichtlich „eigentlich”. Weil, wie wir wissen. Ein Deutscher, der seit drei Jahren in einer Krakauer Buchhandlung arbeitet. Ein Deutscher, der seit fünf Jahren an der Jagiellonen-Universität römisches Recht lehrt. Eine Schweizer Stipendiatin. Wir alle haben eine Staatsbürgerschaft. Für Nichts und wieder Nichts. Besitzen einen Pass. Zum Schein. Und zur Erleichterung von Grenzüberschreitungen. In Wirklichkeit ziehen wir es vor. In Polen. Zu leben, zu arbeiten, wenig zu verdienen, eine gute Zeit zu verbringen.
Martin der Übersetzer. Übersetzte einen Auszug aus „Seiden”. Aus dem Deutschen ins Englische. Erstaunlich gut. Und so spricht er auch Polnisch. Erstaunlich gut. Seit über einem Monat wechseln wir regelmäßig nachmitternächtliche emails. Treffen uns in der Buchhandlung. Er schäumt Milch für meine Latte Macchiato. Oder ist mit der Waschmaschine beschäftigt. In dieser Buchhandlung ist alles möglich. Und vorhanden. Martin ist sehr jung. Sehr sensibel. Sieht eher aus wie ein Mensch der Musik. Dachte ich. Irgendeinmal ganz am Anfang. Beiläufig. Sinnlos. Niemand braucht solche Gedanken.
In der Nacht vor meiner Abreise nach Rzeszów begriff ich endlich. Wir sind nicht gewappnet. Gegen Verstehen. Oder Nichtverstehen. Dummheit. Geistige Schlitzohrigkeit. Der Himmel weiß, woher das alles kommt und wohin es geht. Im Frühling, kaum zurück aus Japan, fuhr ich zu einem Tai Chi Wochenende ans Meer. Nach Usedom. Ahlbeck. An die Grenze. Zu Polen. Ich erinnerte mich an unsere unendlichen Spaziergänge. Während der Mittagspause. Über alten Sand. Im scharfen Wind. Einen Tag in die eine Richtung. Nach Nordosten. Bis nach Heringsdorf. Am nächsten Tag in die andere Richtung. Nach Südosten. Bis zur Landesgrenze. Auf feuchtem Sand. Und dort irgendwo an der salzarmen Ostsee zwischen dem einen Land und dem anderen, in the middle of nowhere, erzählte mir die Flötenlehrerin von ihrem Schüler. Der nach Polen „emigriert“ sei. Nach Krakau. Ich wunderte mich. Die Lehrerin ist jung, wie kann sie erwachsene, volljährige Schüler haben? Sie erzählte unbekümmert weiter, dass sie ihn einmal besucht habe. In Krakau. Dass er in einer Buchhandlung arbeite.
Und in der Tat. Erst in der Nacht vor meiner Abreise nach Rzeszów. Begriff ich. Dass es nicht zwei Entflohene geben kann. Aus Deutschland. Dass es Martin der Übersetzer aus dem Deutschen ins Englische sein muss. Es gibt ja noch einen anderen Martin. Der übersetzt. Aus dem Polnischen ins Deutsche. Von ihm später mehr. Ich begriff, dass Martin, mein Übersetzer, der Altblockflötenschüler der Berliner Tai Chi praktizierenden Flötenlehrerin sein muss.
Auch der dritte Martin, mein Chen Taijichuan-Lehrer ist allgegenwärtig in meinem Krakauer Alltag. Jeden Tag denke ich an ihn, wenn ich nicht die neue Form übe, die er mir beizubringen versucht. Sondern die alte, die mir von Berlin vertraut ist. Und bereits in meinem Körper Platz genommen hat.
Gestern war ich zum ersten Mal im Zimmer von Martin, dem Älteren unter mir. Im Łaskihaus. Bei Tageslicht. Ich gestehe, dass ich schon das eine oder andere Mal abends bei ihm sass. Bei einem bescheidenen Gläschen Rotwein. Wenn in der Küche Kochrituale zu Gange waren. Und uns der Fettgestank zu Leibe rückte. Gestern früh klopfte ich also an die Tür von Martin, dem Älteren. Der auch Übersetzer ist. Bevor er das Haus Richtung Bibliothek verließ. Kein Morgenmuffel. Dieser Martin ist eher ein Mensch der Bücher als ein Mensch der Musik, geschweige denn der Sopran- oder Altflöte. Ich bat ihn, mir zwei Angaben zu überprüfen. Zwei Bücher auszuleihen. Ein paar Seiten zu kopieren (es geht natürlich um General Bijak). Ich hatte keine Lust auf Bibliothek. Nicht an diesem Morgen. Und an keinem anderen. Ich sah vor seinem Fenster den alten Baumstamm. Und begriff, dass dies der Anfang des Baumes sein musste, der über meinem Dachfenster im Himmel endet. Ich starre täglich stundenlang in seine kahlen Äste. Die im blassen Winterhimmel aussehen wie die Ärmchen unzähliger hungriger Kinder. Unten, vor Martins Fenster, steht der Baumstamm. Und sieht nicht gesund aus. Alt. Müde. Morsch. Bei mir oben zeigt er weder sein Alter noch seine Wunden. Tut jung und übermütig. Gierig. Nach dem Leben.
Es wimmelt von Martins. Gestern Abend versammelten wir uns geschlossen, die ganze Belegschaft des Łaskihauses, alle großen und kleinen „M“, aber auch sämtliche anderen Buchstaben des Alphabets – zu einem literarischen Abend im Goethe Institut. Dort sass auch Martin, der Übersetzer ins Englische und Flötenschüler meiner Tai Chi Freundin. Gegen Ende der Veranstaltung, niemand weiß warum, gegen Ende dieses multimedialen happenings zum Stichwort „junge berliner szene“ wurde ein Stück kurzer Prosa von Tilmann Rammstedt gelesen. Titel: Das Mundstück. Protagonistin: die Flötenlehrerin. Protagonist: der Ich-Erzähler, ehemaliger Schüler der Flötenlehrerin.
11.12.05
Julian Przyboś Grundschule Nr. 12 in Rzeszów
Premiere für mich: Auftritt in der Schule. In Polen. In Rzeszów. In der Welt. Noch nie hatte ich eine Lesung in einer Schule. In keinem Land der Erde.
Die Kinder waren sehr freundlich. Weniger nervös als ich. Natürlich. Vielleicht etwas aufgeregter. Gut vorbereitete von der Klassenlehrerin. Der Polnischlehrerin. Agnieszka W. Klasse IV b. Wie schön! Ich fühlte mich sofort besser. Denn ich habe meine Schulzeit vorwiegend in solchen „b”-Klassen verbracht. Und die sind nicht schlechter als die „a“-Klassen.
Dumme Fragen gab es keine. Obwohl die Schuldirektorin die Schüler gerade vor solchen warnte. Während sie mich begrüsste. Dafür schwirrten tonnenschwere Fragen. Durch die Luft. Ich bin ja schließlich hier die Ignorantin. Und habe keine Ahnung. In welcher Welt die Jugend lebt. Wofür sich Schüler der sechsten Grundschulklasse interessieren. Können. Ich weiß nichts von Sportlern (ich kannte gerade Adam Małysz, der hat mir das Gesicht gerettet, und Simon Amman). Sie fragten zum Beispiel, warum ich nach Rzeszów gekommen sei. Weil ich hier Freunde habe. Seit Jahren. Seit einer Ewigkeit. Seit einem Vierteljahrhundert. Deshalb fahre ich auch nach Gorlice, nach Kwiatonowice, nach Gdańsk, nach Purzyce, nach Warszawa, nach Zbucz ... Weil ich Freund habe. In diesem Land. Ich lernte den Mann der Lehrerin in den achtziger Jahren kennen. In Fribourg. Da verriet ich ihnen nicht. Wir studierten damals zusammen bei meinem Doktorvater. Drückten vielleicht dieselbe Schulbank. Ich weiß es nicht mehr. Ob jener Vorlesungssaal mit Schulbänken bestückt war. Aber alles ist möglich. Immer. Das vergaß ich ihnen zu sagen. Dass der Weg nach Rzeszów natürlich in der Westschweiz beginnt. Immer. In der Grenzstadt zwischen der französischen und der deutschen Schweiz. Jan, der Mann von Agnieszka, der Klassenlehrerin, gestand mir vorgestern übrigens mitten im Rzeszower Dauerschneeregen. Dass er heute seine Jahre in der Schweiz ganz anders nutzen würde. An der Universität Fribourg. So ist das immer. Der Mensch wird klüger mit dem Alter. Aber was heißt das? Die Zeit, die wir an einem fremden Ort verbringen, ist nie verloren.
Sie wollten natürlich wissen, warum es mir in Polen gefällt. Schon zwölfjährige Kinder aus Rzeszów wissen, dass es seltsam, gar abnormal ist, dass eine Schweizerin sich in Polen wohl fühlt. Und in der Schweiz unwohl. Mein Gott! Was sollte ich auf diese Frage antworten? Dass ich seelenruhig mein ganzes Leben im Berlin-Warschau-Express (nur in dieser Richtung!) verbringen könnte und hinausstarren auf die flache unendliche Mazowszelandschaft. Oder im Bummelzug, Personenzug, im langsamsten, der von Krakau nach Rzeszów fährt. Denn auch hier sieht die Welt wohltuend ebenmäßig aus. Die Stadt liegt im Tal der Wisłoka, im Karpatenvorland. Das heißt, die Berge sind weit, weit weg. Und stören nicht. Verstellen nicht meine Gedanken. Und Phantasien. Wie eine mit diversen Kisten vollgestellte Lagerhalle. Die Sonne ist hier zu sehen. Der Himmel ist hier zu sehen. Und die vorüberziehenden Wolken.
Sie fragten, woher die Ideen kommen. Auch eine schwierige Frage. Sie kommen. Oder kommen nicht. Irgendwie wachsen sie. Sprießen. Manchmal aus ganz dummen, einfachen Dingen. Schon deshalb kann es keine dummen Fragen geben. Die Engelin gießt meine seltsamen Einfälle. Im Zimmer unter dem Dach. In Krakau. In der Nacht. Während ich traumlos schlafe. Die Ideen nähren sich von meiner Konzentration. Von konzentrierten Gedanken. Hirnkonzentrat. Ablenkungen werden kaum zugelassen.. Aber am schwierigsten sind die Momente, in denen wir nicht wissen, dass wir uns und auf was wir uns konzentrieren sollen. In denen wir ahnungslos sind. Nicht wissen, worauf es ankommt. Wachsam bleiben. Und offen sein. In alle Himmelsrichtungen. Und das gelingt immer noch am besten in einer weitläufig sandigen Landschaft. Die Gedanken dürfen nicht mit hochalpinem Granit verstellt werden. Das ist schwer zu verstehen, ich gestehe. Für Grundschulschüler.
Nicht für jeden Menschen ist das Gleiche in gleichem Masse wichtig. Jeder muss seinen Platz finden, seine Aufgabe, seine Nahrung. Seine Cerebrospinalflüssigkeit. Punkt.
Die letzte Frage war die klügste. Warum alle meine „Postkarten aus Berlin“, die ich seit Jahren für die Rzeszower Literaturzeitschrift „FRAZA“ schreibe, mit „Meine Lieben“ anfangen?
Die Form der Postkarte verlangt eine gewisse Art der Höflichkeit. Finde ich. Wie ein Brief. Wie eine email. Wie eine sms. Deswegen benütze ich eine Anredeform. Wende ich mich an irgendjemanden. Natürlich habe ich, wenn ich Postkarten schreibe, konkrete Empfänger im Kopf. So konkret, dass ich genauso gut ihre Namen nennen könnte. Aber das macht die Sache wieder unnötig kompliziert. Dann ist der eine eifersüchtig, weil ich seinem Kollegen schreibe. Der andere böse, weil er eine zu kurze Postkarte bekommt. Der dritte will nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich ihm eine langweilige Karte geschickt habe. Und der vierte beklagt sich, dass er eine schwarzweiße aus dem Briefkasten gezogen hat.Nicht immer ist das Leben bunt. Deshalb schreibe ich lieber an ein anonymes Kollektiv von Freunden. Meine Lieben! Natürlich. Alle Postkarten werden von Berlin nach Rzeszów geschickt. Und sind so etwas wie eine Liebeserklärung. An Rzeszów. Ich Liebe Euch Alle.
Warum von Berlin aus? Weil ich einen Berliner geheiratet habe. Das ist auch eine Liebeserklärung. In Berlin bin ich näher an Polen als irgendwo sonst auf der Welt. Ganz bestimmt näher als in der Schweiz. Danke für die Aufmerksamkeit.
Die Kinder waren sehr freundlich. Weniger nervös als ich. Natürlich. Vielleicht etwas aufgeregter. Gut vorbereitete von der Klassenlehrerin. Der Polnischlehrerin. Agnieszka W. Klasse IV b. Wie schön! Ich fühlte mich sofort besser. Denn ich habe meine Schulzeit vorwiegend in solchen „b”-Klassen verbracht. Und die sind nicht schlechter als die „a“-Klassen.
Dumme Fragen gab es keine. Obwohl die Schuldirektorin die Schüler gerade vor solchen warnte. Während sie mich begrüsste. Dafür schwirrten tonnenschwere Fragen. Durch die Luft. Ich bin ja schließlich hier die Ignorantin. Und habe keine Ahnung. In welcher Welt die Jugend lebt. Wofür sich Schüler der sechsten Grundschulklasse interessieren. Können. Ich weiß nichts von Sportlern (ich kannte gerade Adam Małysz, der hat mir das Gesicht gerettet, und Simon Amman). Sie fragten zum Beispiel, warum ich nach Rzeszów gekommen sei. Weil ich hier Freunde habe. Seit Jahren. Seit einer Ewigkeit. Seit einem Vierteljahrhundert. Deshalb fahre ich auch nach Gorlice, nach Kwiatonowice, nach Gdańsk, nach Purzyce, nach Warszawa, nach Zbucz ... Weil ich Freund habe. In diesem Land. Ich lernte den Mann der Lehrerin in den achtziger Jahren kennen. In Fribourg. Da verriet ich ihnen nicht. Wir studierten damals zusammen bei meinem Doktorvater. Drückten vielleicht dieselbe Schulbank. Ich weiß es nicht mehr. Ob jener Vorlesungssaal mit Schulbänken bestückt war. Aber alles ist möglich. Immer. Das vergaß ich ihnen zu sagen. Dass der Weg nach Rzeszów natürlich in der Westschweiz beginnt. Immer. In der Grenzstadt zwischen der französischen und der deutschen Schweiz. Jan, der Mann von Agnieszka, der Klassenlehrerin, gestand mir vorgestern übrigens mitten im Rzeszower Dauerschneeregen. Dass er heute seine Jahre in der Schweiz ganz anders nutzen würde. An der Universität Fribourg. So ist das immer. Der Mensch wird klüger mit dem Alter. Aber was heißt das? Die Zeit, die wir an einem fremden Ort verbringen, ist nie verloren.
Sie wollten natürlich wissen, warum es mir in Polen gefällt. Schon zwölfjährige Kinder aus Rzeszów wissen, dass es seltsam, gar abnormal ist, dass eine Schweizerin sich in Polen wohl fühlt. Und in der Schweiz unwohl. Mein Gott! Was sollte ich auf diese Frage antworten? Dass ich seelenruhig mein ganzes Leben im Berlin-Warschau-Express (nur in dieser Richtung!) verbringen könnte und hinausstarren auf die flache unendliche Mazowszelandschaft. Oder im Bummelzug, Personenzug, im langsamsten, der von Krakau nach Rzeszów fährt. Denn auch hier sieht die Welt wohltuend ebenmäßig aus. Die Stadt liegt im Tal der Wisłoka, im Karpatenvorland. Das heißt, die Berge sind weit, weit weg. Und stören nicht. Verstellen nicht meine Gedanken. Und Phantasien. Wie eine mit diversen Kisten vollgestellte Lagerhalle. Die Sonne ist hier zu sehen. Der Himmel ist hier zu sehen. Und die vorüberziehenden Wolken.
Sie fragten, woher die Ideen kommen. Auch eine schwierige Frage. Sie kommen. Oder kommen nicht. Irgendwie wachsen sie. Sprießen. Manchmal aus ganz dummen, einfachen Dingen. Schon deshalb kann es keine dummen Fragen geben. Die Engelin gießt meine seltsamen Einfälle. Im Zimmer unter dem Dach. In Krakau. In der Nacht. Während ich traumlos schlafe. Die Ideen nähren sich von meiner Konzentration. Von konzentrierten Gedanken. Hirnkonzentrat. Ablenkungen werden kaum zugelassen.. Aber am schwierigsten sind die Momente, in denen wir nicht wissen, dass wir uns und auf was wir uns konzentrieren sollen. In denen wir ahnungslos sind. Nicht wissen, worauf es ankommt. Wachsam bleiben. Und offen sein. In alle Himmelsrichtungen. Und das gelingt immer noch am besten in einer weitläufig sandigen Landschaft. Die Gedanken dürfen nicht mit hochalpinem Granit verstellt werden. Das ist schwer zu verstehen, ich gestehe. Für Grundschulschüler.
Nicht für jeden Menschen ist das Gleiche in gleichem Masse wichtig. Jeder muss seinen Platz finden, seine Aufgabe, seine Nahrung. Seine Cerebrospinalflüssigkeit. Punkt.
Die letzte Frage war die klügste. Warum alle meine „Postkarten aus Berlin“, die ich seit Jahren für die Rzeszower Literaturzeitschrift „FRAZA“ schreibe, mit „Meine Lieben“ anfangen?
Die Form der Postkarte verlangt eine gewisse Art der Höflichkeit. Finde ich. Wie ein Brief. Wie eine email. Wie eine sms. Deswegen benütze ich eine Anredeform. Wende ich mich an irgendjemanden. Natürlich habe ich, wenn ich Postkarten schreibe, konkrete Empfänger im Kopf. So konkret, dass ich genauso gut ihre Namen nennen könnte. Aber das macht die Sache wieder unnötig kompliziert. Dann ist der eine eifersüchtig, weil ich seinem Kollegen schreibe. Der andere böse, weil er eine zu kurze Postkarte bekommt. Der dritte will nichts mehr mit mir zu tun haben, weil ich ihm eine langweilige Karte geschickt habe. Und der vierte beklagt sich, dass er eine schwarzweiße aus dem Briefkasten gezogen hat.Nicht immer ist das Leben bunt. Deshalb schreibe ich lieber an ein anonymes Kollektiv von Freunden. Meine Lieben! Natürlich. Alle Postkarten werden von Berlin nach Rzeszów geschickt. Und sind so etwas wie eine Liebeserklärung. An Rzeszów. Ich Liebe Euch Alle.
Warum von Berlin aus? Weil ich einen Berliner geheiratet habe. Das ist auch eine Liebeserklärung. In Berlin bin ich näher an Polen als irgendwo sonst auf der Welt. Ganz bestimmt näher als in der Schweiz. Danke für die Aufmerksamkeit.
10.12.05
Hochzeitstag
 Vor zwölf Jahren um 17 Uhr Ortszeit, es war ein eisiger verschneiter Freitag, wurde unsere Ehe im Warschauer Standesamt Nr. 1 geschlossen. Wir gaben uns kein JA-Wort, sondern versprachen in polnisch-deutscher fließender poetischer Prosa (Autor unbekannt) ewige Liebe, Treue und Fürsorge. Wolfgang behauptet bis heute, nichts verstanden zu haben. Geblendet von den Amtsinsignien des Standesbeamten. Ich durfte nicht übersetzen, da ich als befangen galt. Unser Freund Piotr, Germanist, gab ohne zu Stocken sein Bestes.
Vor zwölf Jahren um 17 Uhr Ortszeit, es war ein eisiger verschneiter Freitag, wurde unsere Ehe im Warschauer Standesamt Nr. 1 geschlossen. Wir gaben uns kein JA-Wort, sondern versprachen in polnisch-deutscher fließender poetischer Prosa (Autor unbekannt) ewige Liebe, Treue und Fürsorge. Wolfgang behauptet bis heute, nichts verstanden zu haben. Geblendet von den Amtsinsignien des Standesbeamten. Ich durfte nicht übersetzen, da ich als befangen galt. Unser Freund Piotr, Germanist, gab ohne zu Stocken sein Bestes.
 Vor zwölf Jahren um 17 Uhr Ortszeit, es war ein eisiger verschneiter Freitag, wurde unsere Ehe im Warschauer Standesamt Nr. 1 geschlossen. Wir gaben uns kein JA-Wort, sondern versprachen in polnisch-deutscher fließender poetischer Prosa (Autor unbekannt) ewige Liebe, Treue und Fürsorge. Wolfgang behauptet bis heute, nichts verstanden zu haben. Geblendet von den Amtsinsignien des Standesbeamten. Ich durfte nicht übersetzen, da ich als befangen galt. Unser Freund Piotr, Germanist, gab ohne zu Stocken sein Bestes.
Vor zwölf Jahren um 17 Uhr Ortszeit, es war ein eisiger verschneiter Freitag, wurde unsere Ehe im Warschauer Standesamt Nr. 1 geschlossen. Wir gaben uns kein JA-Wort, sondern versprachen in polnisch-deutscher fließender poetischer Prosa (Autor unbekannt) ewige Liebe, Treue und Fürsorge. Wolfgang behauptet bis heute, nichts verstanden zu haben. Geblendet von den Amtsinsignien des Standesbeamten. Ich durfte nicht übersetzen, da ich als befangen galt. Unser Freund Piotr, Germanist, gab ohne zu Stocken sein Bestes.
8.12.05
Rzeszów
Es regnet immer noch. In einer Stunde fahre ich nach Rzeszów. Zu meinen Freunden. Die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Heute Abend Lesung aus "Seiden - Mein Winter in Japan" im Pub "Va Bank". Morgen Auftritt in der Schule, in Agnieszkas Klasse. Übermorgen bin ich wieder da.
7.12.05
General Juljusz Bijak

Das einzige Foto, das ich bisher finden konnte.
Wer kennt diesen Mann?
Geboren am 14. September 1860 in Biadoliny. Gestorben am 21. April 1943 in Wadowice.
Wo sind die Briefe, die ihm Lina Bögli von Februar bis Juli 1892 geschrieben hat? Bevor sie die Beziehung und das Gespräch mit ihm abbrach und zehn Jahre um die Welt reiste. Er wollte die Briefe, im Falle eines Krieges, "in sichere Hände geben". Aber - lang ist's her ...

Das einzige Foto, das ich bisher finden konnte.
Wer kennt diesen Mann?
Geboren am 14. September 1860 in Biadoliny. Gestorben am 21. April 1943 in Wadowice.
Wo sind die Briefe, die ihm Lina Bögli von Februar bis Juli 1892 geschrieben hat? Bevor sie die Beziehung und das Gespräch mit ihm abbrach und zehn Jahre um die Welt reiste. Er wollte die Briefe, im Falle eines Krieges, "in sichere Hände geben". Aber - lang ist's her ...
6.12.05
Die zweite Engelin
Es regnet. Und meine Engelin mit der Gießkanne hat nichts zu tun. Sie wartet geduldig mit mir zusammen. Bis das Wetter sich ändert.
Nikolaus irrte sich in der Nacht in der Adresse. Er legte mein Päckchen bei Frau Krakowska ab. Frau Krakowska dachte sich gleich, dass das in Geschenkpapier eingewickelte Ding für mich sein musste. Aber Nikolaus war bereits über alle Berge. So benachrichtige sie mich per SMS, dass eine kleine hölzerne Engelin zu ihr geflogen kam. Mit leichten Flügeln. Wie ein Lilienthalgleiter. An ihren Bauch gebunden. Mit einem Zwirnfaden. Ein Päckchen. Schreibt Frau Krakowska. Für Dich.
Die Enkelin meines Schwiegervaters, die Tochter von Wolfgangs Bruder, die Tochter meiner Schwägerin – was genau ist sie nun für mich? – heißt Martina und ist am gleichen Tag geboren wie ich. Ein paar Jahre später natürlich. Mit diesen Worten könnte nun „Martin zum Fünften …“ beginnen. Aber hier gibt es nichts zu scherzen. Martina steht mit mir in Mobilfunkkontakt. Seit Schwiegervater Geburtstag hatte und ins Krankenhaus kam. Bin ich eine Informationsschaltzentrale. Sie ruft mich. An. Ich versuche Wolfgang. Zu erreichen. Mit ihm in Kontakt. Zu treten. Am anderen Ende der Welt. Über die Wellen des südchinesischen Meeres hinweg. Er überquerte heute das Perlflussdelta. Auf dem Weg nach Macao. Zu einer Konferenz. Was für ein Mensch! Martina ist in meinem polnischen Handy gespeichert als „Martina“. Wie sonst. Und jedesmal, wenn es klingelt und der kleine Bildschirm mir sagt „Martina ruft an – abnehmen JA oder NEIN?“ zögere ich einen kurzen, schweren Augenblick lang.
Ich habe eine zweite Engelin bekommen. Aus Holz. Leicht wie Schlaf. Jetzt warten wir geduldig. Zu dritt. Bis das Wetter sich ändert.
Nikolaus irrte sich in der Nacht in der Adresse. Er legte mein Päckchen bei Frau Krakowska ab. Frau Krakowska dachte sich gleich, dass das in Geschenkpapier eingewickelte Ding für mich sein musste. Aber Nikolaus war bereits über alle Berge. So benachrichtige sie mich per SMS, dass eine kleine hölzerne Engelin zu ihr geflogen kam. Mit leichten Flügeln. Wie ein Lilienthalgleiter. An ihren Bauch gebunden. Mit einem Zwirnfaden. Ein Päckchen. Schreibt Frau Krakowska. Für Dich.
Die Enkelin meines Schwiegervaters, die Tochter von Wolfgangs Bruder, die Tochter meiner Schwägerin – was genau ist sie nun für mich? – heißt Martina und ist am gleichen Tag geboren wie ich. Ein paar Jahre später natürlich. Mit diesen Worten könnte nun „Martin zum Fünften …“ beginnen. Aber hier gibt es nichts zu scherzen. Martina steht mit mir in Mobilfunkkontakt. Seit Schwiegervater Geburtstag hatte und ins Krankenhaus kam. Bin ich eine Informationsschaltzentrale. Sie ruft mich. An. Ich versuche Wolfgang. Zu erreichen. Mit ihm in Kontakt. Zu treten. Am anderen Ende der Welt. Über die Wellen des südchinesischen Meeres hinweg. Er überquerte heute das Perlflussdelta. Auf dem Weg nach Macao. Zu einer Konferenz. Was für ein Mensch! Martina ist in meinem polnischen Handy gespeichert als „Martina“. Wie sonst. Und jedesmal, wenn es klingelt und der kleine Bildschirm mir sagt „Martina ruft an – abnehmen JA oder NEIN?“ zögere ich einen kurzen, schweren Augenblick lang.
Ich habe eine zweite Engelin bekommen. Aus Holz. Leicht wie Schlaf. Jetzt warten wir geduldig. Zu dritt. Bis das Wetter sich ändert.
5.12.05
Nebel
Gestern Abend versank unvermittelt die ganze Stadt im Nebel. Ich stand an der Haltestelle Bagatela und wartete auf den Bus. Und plötzlich verschwand alles. Die Straßen waren ausgestorben. Ab und zu zog noch eine schläfrige Straßenbahn vorbei. Und dann war auch dieses Spektakel zu Ende. Und nur noch der vordere Scheinwerfer näherte sich. Sehr undeutlich. Eine milchig Kugel. Mehr nicht.
Und in diesem Moment ergriff mich eine unendliche Sehnsucht. Unerhört. Und unerträglich. Als ob sie nur auf diesen einen und einzigen Augenblick gewartet hätte, in dem sie, die riesige, unförmige, aufgeblasene, freche, hässliche Sehnsucht in meiner Welt Platz nehmen kann. Ungeniert. Sich ausbreiten. In meinen Träumen. In meinen Gedanken. In meinen Muskeln.
Ich sehne mich. Aber ich sehne mich nicht nach meinem Land. Noch nach irgendeinem Ort. Weder nach einem fassbaren. Noch unfassbaren. Weder nach dem Erzengel in Berlin. Noch nach meinem hundertjährigen Liegnitz. Weder nach dem Kleiderschrank. Noch nach dem Bügeleisen. Noch nach dem Bücherregal. Noch nach dem Schuhschrank.
Ich sehne mich. Nur nach Wolfgang. Während ich an der Haltestelle stehe. Umgeben von undurchdringlichem Nebel. Während ich auf nichts warte. Denn hier ist alles auf einen Schlag verschwunden. Und nach nichts anderem. Sehne ich mich. Nach niemandem sonst. Unser Pinguinleben ist kaum mehr zu ertragen. Rücken an Rücken. Schwarz an Schwarz. Die halbe Welt dazwischen. Oder auch die ganze. In meinem Zimmer unter dem Dach ist es warm. Aber leer rund um meinen Kopf. Und an den Ellbogen. An der Haltestelle Bagatela. Bei ihm ist schon tiefe Nacht. Er schläft im Hotel Ramada, im Zimmer 2010, in Hongkong. Wieder einmal ist es uns nicht gelungen, miteinander zu sprechen. Irgendwann (beim letzten Vollmond!) schickte ich ihm von dieser Haltestelle aus eine SMS, dass ich, während ich auf den Bus warte (alles wiederholt sich), den Vollmond sehe. Und eine Sekunde später kam die Antwort, dass er ihn auch sehe. Damals war er in Stralsund, stand auf dem Balkon und starrte in den Abendhimmel. Wie ich. An den Krakauer Planty. Damals befanden wir uns noch irgendwie in der selben Zeit. Obwohl wir nicht zusammen waren. So doch immerhin gleichzeitig. Jetzt ist es schwierig, sich zu einem Anruf zu verabreden. Oder gar unmöglich.
Ich sehne mich nach meinem eigenen Ehemann. Der in Stanley, im Süden der Stadt, in einem Thailändischen Restaurant hervorragend zu Abend gegessen hat. Zusammen mit einem Kollegen. Und sich, wie er in der email schrieb, „unanständig“ gut fühlte. Über der Stanley Bucht. Mit Sicht auf das Südchinesische Meer. Bei einer leichten Brise. Um die Nase. In Gedanken bei seinem kranken Vater im Berliner Krankenhaus. Das Leben schwankt wie eine müde Straßenbahn durch dichten Nebel. Nur der vordere Scheinwerfer ist zu sehen. Sehr undeutlich. Eine milchig Kugel. Mehr nicht. Aber immerhin.
Heute früh klingelte das Telefon. Mein Stipendium wird verlängert. Ich bleibe bis Ende März 2006 in der Villa.
Und in diesem Moment ergriff mich eine unendliche Sehnsucht. Unerhört. Und unerträglich. Als ob sie nur auf diesen einen und einzigen Augenblick gewartet hätte, in dem sie, die riesige, unförmige, aufgeblasene, freche, hässliche Sehnsucht in meiner Welt Platz nehmen kann. Ungeniert. Sich ausbreiten. In meinen Träumen. In meinen Gedanken. In meinen Muskeln.
Ich sehne mich. Aber ich sehne mich nicht nach meinem Land. Noch nach irgendeinem Ort. Weder nach einem fassbaren. Noch unfassbaren. Weder nach dem Erzengel in Berlin. Noch nach meinem hundertjährigen Liegnitz. Weder nach dem Kleiderschrank. Noch nach dem Bügeleisen. Noch nach dem Bücherregal. Noch nach dem Schuhschrank.
Ich sehne mich. Nur nach Wolfgang. Während ich an der Haltestelle stehe. Umgeben von undurchdringlichem Nebel. Während ich auf nichts warte. Denn hier ist alles auf einen Schlag verschwunden. Und nach nichts anderem. Sehne ich mich. Nach niemandem sonst. Unser Pinguinleben ist kaum mehr zu ertragen. Rücken an Rücken. Schwarz an Schwarz. Die halbe Welt dazwischen. Oder auch die ganze. In meinem Zimmer unter dem Dach ist es warm. Aber leer rund um meinen Kopf. Und an den Ellbogen. An der Haltestelle Bagatela. Bei ihm ist schon tiefe Nacht. Er schläft im Hotel Ramada, im Zimmer 2010, in Hongkong. Wieder einmal ist es uns nicht gelungen, miteinander zu sprechen. Irgendwann (beim letzten Vollmond!) schickte ich ihm von dieser Haltestelle aus eine SMS, dass ich, während ich auf den Bus warte (alles wiederholt sich), den Vollmond sehe. Und eine Sekunde später kam die Antwort, dass er ihn auch sehe. Damals war er in Stralsund, stand auf dem Balkon und starrte in den Abendhimmel. Wie ich. An den Krakauer Planty. Damals befanden wir uns noch irgendwie in der selben Zeit. Obwohl wir nicht zusammen waren. So doch immerhin gleichzeitig. Jetzt ist es schwierig, sich zu einem Anruf zu verabreden. Oder gar unmöglich.
Ich sehne mich nach meinem eigenen Ehemann. Der in Stanley, im Süden der Stadt, in einem Thailändischen Restaurant hervorragend zu Abend gegessen hat. Zusammen mit einem Kollegen. Und sich, wie er in der email schrieb, „unanständig“ gut fühlte. Über der Stanley Bucht. Mit Sicht auf das Südchinesische Meer. Bei einer leichten Brise. Um die Nase. In Gedanken bei seinem kranken Vater im Berliner Krankenhaus. Das Leben schwankt wie eine müde Straßenbahn durch dichten Nebel. Nur der vordere Scheinwerfer ist zu sehen. Sehr undeutlich. Eine milchig Kugel. Mehr nicht. Aber immerhin.
Heute früh klingelte das Telefon. Mein Stipendium wird verlängert. Ich bleibe bis Ende März 2006 in der Villa.
2.12.05
Martin zum Vierten
Dafür kann ich nun wirklich nichts. Ein weiterer Martin ist angekommen. Stipendiatenwechsel. Monatswechsel. Quartalswechsel. Geht alles nicht so richtig auf Anfang Dezember. Auch Marc wohnt jetzt hier. Es wimmelt nur so von großen „Ms“. Und geschwungenen, großen und kleinen „eS“. Wie Sonnenblumenhonig. Schmalzbutter. Senfgläser. Schmeißfliege. Schalentier. Und so weiter. Und so fort.
Manchmal wissen wir in der Tat nicht, warum wir zu gegebener Stunde das eine tun, und das andere lassen. Ehrlich gesagt, verstanden wir vorgestern, während der Andreasnacht, gar nicht, warum wir im Łaskihaus das Unaufgegessene von weiß der Himmel wie vielen Stipendiaten in weiß der Teufel welchem Zustand in Mülltüten stopfen mussten. Warum ausgerechnet wir – ich und der alte (im Sinne der Aufenthaltsdauer in der Villa) Martin. Aber wir taten es. Weil die Putzfrau darum gebeten hatte. Und weil wir nichts Besseres zu tun hatten. Das plötzlich leergewordene Haus forderte sein Recht. Wir mussten uns daran gewöhnen. Ein Wort fand sich dann sogar fast wie von selbst. In der Küche. In diesem Sinne war der Abend nicht ganz verloren. Außerdem sind gute Beziehungen zu Putzfrauen und Hausmeistern immer von Vorteil. Überall auf der Welt.
Heute erst habe ich begriffen, warum die beiden Kühlschränke, die Unter- und Überschränke, alle Schubladen und das ganze riesige Vorratsregal entleert, gesäubert und desinfiziert werden mussten. Weil der neue (im Sinne der Aufenthaltsdauer in der Villa) Martin am Abend mit seiner Freundin in die Küche kam. Zuerst schleiften sie zu zweit einen riesigen Rucksack über den Boden und ließen ihn liegen. War wohl sehr schwer. Dann rannten sie nochmals mehrmals hinaus und brachten pralle Tüten und Taschen an. So viel sie nur tragen konnten.
„Wir waren auf der Jagd“, warf mir der neue Martin schnaufend zu.
Ich verstand den Witz natürlich nicht. Mehr sagte er aber auch nicht. Weil er bereits wieder verschwunden war. Ich suchte nach dem Hirschgeweih. Er hatte sich nicht einmal vorgestellt. So stellte ich mich vor. Als er mit den nächsten vollen Einkaufstüten durch die Tür trat. Und fragte, ob sie meine neuen Nachbarn seien. Heute früh hatte ich nämlich eine Matratze entdeckt. Im Korridor, unter dem Dach, vor meinem Zimmer. Eingerollt in eine durchsichtige Plastikfolie. Und zugeklebt. Und rundherum von oben bis unten mit schwarzem Filzstift beschriftet. „Das ist die Matratze von Martin ... (+ Nachname, den ich hier aus Datenschutzgründen nicht nennen will), ich wohne dort …(+ Pfeil nach rechts).“
Der neue Martin stellte gleich richtig, dass nur er mein Nachbar sei. Sie würde ihn von Zeit zu Zeit besuchen. Ihren Namen nannte er nicht. Weder er. Noch sie. Egal. So genau wollte ich das ja nicht wissen. Bettgeschichten interessieren mich nicht. Ihre Matratze steht eingerollt im Flur. Derweil sie Einkäufe auspackten. Auf dem langen Tisch ausbreiteten. Sie fing an, mit einem feuchten Lappen Dosen und Gläser abzustauben … Ich floh. In der Küche war kein Platz mehr. Mehrere Kilogramm Mehl, mindestens 25 Einpfundpackungen Spaghetti. Ebenso viele andere Nudeln. Bestimmt auch einige Kilogramm Reis, Salz, Zucker. Ein paar Dutzend Dosen mit Erbsen und anderem. Gläser mit roten Rüben. Apfelmus. Schokolade, Kekse, Trockenfutter. Schwarzteebeutel, Kräuterteebeutel, Kaffeebeutel, Säfte, Bier, Wein …
Du liebe Güte! Was soll das bloß werden? Notvorräte wie für eine abgeschiedene Berghütte. Wie für den Kriegsfall. Wie für eine Kompanie ausgehungerter Pioniere. An allen Ecken in diesem Land gibt es Supermärkte, die rund um die Uhr offen sind, sieben Tage die Woche. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie mehr als ein Kilo Mehl auf einmal gekauft. Und das reicht meist für fast ein ganzes Jahr. Mehl. Und Martin. Und Matratze. Wozu brachte er seine Matratze mit? Sein Nachname sei, verriet er mir, kurz bevor ich die Küche verließ, in der die Vorräte bereits an den Wänden hochkletterten, wie immergrünes winterhartes Unkraut, schweizerisch-italienisch. Aber er sei Deutscher. Dafür kann ich ja nun wirklich nichts. Ein weiterer Martin ist angekommen. Im ganzen Haus wimmelt es von großen und kleinen „ms“.
Manchmal wissen wir in der Tat nicht, warum wir zu gegebener Stunde das eine tun, und das andere lassen. Ehrlich gesagt, verstanden wir vorgestern, während der Andreasnacht, gar nicht, warum wir im Łaskihaus das Unaufgegessene von weiß der Himmel wie vielen Stipendiaten in weiß der Teufel welchem Zustand in Mülltüten stopfen mussten. Warum ausgerechnet wir – ich und der alte (im Sinne der Aufenthaltsdauer in der Villa) Martin. Aber wir taten es. Weil die Putzfrau darum gebeten hatte. Und weil wir nichts Besseres zu tun hatten. Das plötzlich leergewordene Haus forderte sein Recht. Wir mussten uns daran gewöhnen. Ein Wort fand sich dann sogar fast wie von selbst. In der Küche. In diesem Sinne war der Abend nicht ganz verloren. Außerdem sind gute Beziehungen zu Putzfrauen und Hausmeistern immer von Vorteil. Überall auf der Welt.
Heute erst habe ich begriffen, warum die beiden Kühlschränke, die Unter- und Überschränke, alle Schubladen und das ganze riesige Vorratsregal entleert, gesäubert und desinfiziert werden mussten. Weil der neue (im Sinne der Aufenthaltsdauer in der Villa) Martin am Abend mit seiner Freundin in die Küche kam. Zuerst schleiften sie zu zweit einen riesigen Rucksack über den Boden und ließen ihn liegen. War wohl sehr schwer. Dann rannten sie nochmals mehrmals hinaus und brachten pralle Tüten und Taschen an. So viel sie nur tragen konnten.
„Wir waren auf der Jagd“, warf mir der neue Martin schnaufend zu.
Ich verstand den Witz natürlich nicht. Mehr sagte er aber auch nicht. Weil er bereits wieder verschwunden war. Ich suchte nach dem Hirschgeweih. Er hatte sich nicht einmal vorgestellt. So stellte ich mich vor. Als er mit den nächsten vollen Einkaufstüten durch die Tür trat. Und fragte, ob sie meine neuen Nachbarn seien. Heute früh hatte ich nämlich eine Matratze entdeckt. Im Korridor, unter dem Dach, vor meinem Zimmer. Eingerollt in eine durchsichtige Plastikfolie. Und zugeklebt. Und rundherum von oben bis unten mit schwarzem Filzstift beschriftet. „Das ist die Matratze von Martin ... (+ Nachname, den ich hier aus Datenschutzgründen nicht nennen will), ich wohne dort …(+ Pfeil nach rechts).“
Der neue Martin stellte gleich richtig, dass nur er mein Nachbar sei. Sie würde ihn von Zeit zu Zeit besuchen. Ihren Namen nannte er nicht. Weder er. Noch sie. Egal. So genau wollte ich das ja nicht wissen. Bettgeschichten interessieren mich nicht. Ihre Matratze steht eingerollt im Flur. Derweil sie Einkäufe auspackten. Auf dem langen Tisch ausbreiteten. Sie fing an, mit einem feuchten Lappen Dosen und Gläser abzustauben … Ich floh. In der Küche war kein Platz mehr. Mehrere Kilogramm Mehl, mindestens 25 Einpfundpackungen Spaghetti. Ebenso viele andere Nudeln. Bestimmt auch einige Kilogramm Reis, Salz, Zucker. Ein paar Dutzend Dosen mit Erbsen und anderem. Gläser mit roten Rüben. Apfelmus. Schokolade, Kekse, Trockenfutter. Schwarzteebeutel, Kräuterteebeutel, Kaffeebeutel, Säfte, Bier, Wein …
Du liebe Güte! Was soll das bloß werden? Notvorräte wie für eine abgeschiedene Berghütte. Wie für den Kriegsfall. Wie für eine Kompanie ausgehungerter Pioniere. An allen Ecken in diesem Land gibt es Supermärkte, die rund um die Uhr offen sind, sieben Tage die Woche. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie mehr als ein Kilo Mehl auf einmal gekauft. Und das reicht meist für fast ein ganzes Jahr. Mehl. Und Martin. Und Matratze. Wozu brachte er seine Matratze mit? Sein Nachname sei, verriet er mir, kurz bevor ich die Küche verließ, in der die Vorräte bereits an den Wänden hochkletterten, wie immergrünes winterhartes Unkraut, schweizerisch-italienisch. Aber er sei Deutscher. Dafür kann ich ja nun wirklich nichts. Ein weiterer Martin ist angekommen. Im ganzen Haus wimmelt es von großen und kleinen „ms“.
1.12.05
Schwiegervaters Geburtstag
Schwiegervater wird heute 77. In der Früh musste er notfallmäßig ins Krankenhaus. Wolfgang rief aus Zhuhai an. Zum ersten Mal in seinem Leben war sein Vater nicht in der Lage, mit ihm zu sprechen.
Schwiegermutter empfängt am Nachmittag die Geburtstagsgäste. Was soll sie denn sonst tun? Die Torte ist da, die Kekse gebacken, der Kaffee gekocht. Die Putzfrau auf den morgigen Tag verschoben. Alles geplant und gut durchdacht.
Der Arzt sagt, die Schübe würden nun immer heftiger und in immer kürzeren Abständen erfolgen.
Was heißt das?
Für ihn?
Für uns?
Schwiegermutter empfängt am Nachmittag die Geburtstagsgäste. Was soll sie denn sonst tun? Die Torte ist da, die Kekse gebacken, der Kaffee gekocht. Die Putzfrau auf den morgigen Tag verschoben. Alles geplant und gut durchdacht.
Der Arzt sagt, die Schübe würden nun immer heftiger und in immer kürzeren Abständen erfolgen.
Was heißt das?
Für ihn?
Für uns?


